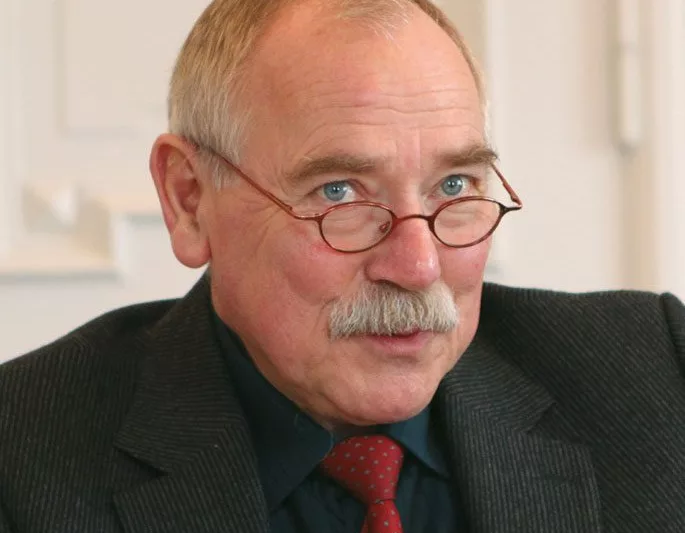Seit den 1990er-Jahren haben sich zahlreiche Kommunen aus unterschiedlichsten Gründen zur Bildung öffentlich-privater Partnerschaften im Bereich der Daseinsvorsorge entschieden. Auch heute sind ÖPP nach wie vor eine gute Möglichkeit, privatwirtschaftliche Kompetenzen für kommunale Pflichten nutzbar zu machen und deren Erfüllung auf vielen Ebenen zu verbessern. Die Vertragslaufzeiten gehen in der Regel über mehrere Jahrzehnte. Vielerorts laufen ÖPP-Verträge aktuell oder in naher Zukunft aus. So auch in Bremen: Hier endet 2028 die Laufzeit für die hanseWasser Bremen GmbH. Der Bremer Senat plant, das Unternehmen anschließend zu rekommunalisieren. Die Handelskammer Bremen und die Unternehmensverbände im Lande Bremen e. V. sehen diesen Schritt kritisch und haben deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die die Vor- und Nachteile einer Rekommunalisierung unter die Lupe nimmt.
Zum Hintergrund: hanseWasser Bremen ist seit 1999 für den Betrieb des städtischen Kanalnetzes und die Abwasserreinigung zuständig. Der Wunsch, das Unternehmen wieder zu kommunalisieren, ist nicht auf Unzufriedenheit der Stadt mit dessen Arbeit zurückzuführen. Im Gegenteil: Der Senat erhofft sich, über diese Maßnahme vielmehr den Erfolg der ÖPP in wirtschaftliche Vorteile für die Stadt und somit geringere Gebühren umzumünzen. Ein weiterer Grund ist der Wunsch nach „mehr Steuerungsmöglichkeiten für eine zukunftsweisende Prioritätensetzung“ (bei einem städtischen Anteil von 25 Prozent ist der aktuelle Einfluss stark begrenzt). Gleichzeitig prüft man aus den gleichen Motiven momentan auch die Rekommunalisierung der Abfalllogistik und Straßenreinigung, deren Verträge ebenfalls jeweils 2028 auslaufen.
Die IHK Bremen und die lokalen Unternehmensverbände befürchten hierdurch jedoch eine Verschlechterung zum Status quo. In einer Pressemitteilung der Handelskammer äußert sich Präses André Grobien: „Der Eindruck, dass der Staat der bessere Unternehmer wäre, trifft unserer Ansicht nach nicht zu. Gerade privatwirtschaftliche Akteure haben einen großen Antrieb, kosteneffizient, innovativ und kundenorientiert zu arbeiten, um am Markt zu bestehen. Diese Vorteile gehen mit einer Rekommunalisierung weitestgehend verloren.“ Eine Entscheidung über die künftige Organisationsform, so heißt es in der Meldung, erfordere die Kenntnis von Vergleichsrechnungen, Sekundäreffekten und Leistungsindikatoren. Diese Faktenbasis für eine sachorientierte Entscheidungsfindung liefert nun die bei der Prognos AG in Auftrag gegebene Studie.
Studie führt Vor- und Nachteile von Rekommunalisierung auf
Die Kurzstudie „Gesellschaftsformen der Abwasser– und Abfallwirtschaft in Bremen – Zurückliegende Entwicklung, Status quo und Perspektiven für die Abfalllogistik“ erörtert zunächst allgemein und ortsunabhängig die unterschiedlichen Vor- und Nachteile von rein öffentlichen Unternehmen einerseits und ÖPP andererseits.
Demnach punkten erstere hauptsächlich durch:
- hohe kommunale Steuerungsmöglichkeit (etwa in Hinblick auf ökologische oder soziale Zielsetzungen),
- Gemeinwohlorientierung,
- Gebührenfinanzierung nach dem Kostendeckungsprinzip,
- vollständigen Verbleib des Gewinns in der Kommune,
- (in der Regel) Ertrags- und Umsatzsteuerbefreiung bei nichtunternehmerischer Tätigkeit,
- Arbeitsplatzsicherheit und starke Bindung an das Tarifrecht.
Häufige Nachteile öffentlicher Unternehmen sind hingegen
- begrenzte Flexibilität durch politische Gremienläufe und Vergaberechtsvorgaben,
- vollständige Finanzierungsrisiken für die Kommune,
- weniger betriebswirtschaftlicher Innovationsdruck,
- Risiko von Ineffizienzen durch politische Einflussnahme,
- Abhängigkeit von der Haushaltslage der Kommune.
Die Vorteile von öffentlich-privaten Partnerschaften liegen wiederum in
- Mischfinanzierung (öffentliche Mittel kombiniert mit privatem Kapital),
- Planungssicherheit und Kostenstabilität durch Leistungsverträge,
- möglicher Gewinnbeteiligung der Kommune (je nach Vertragsgestaltung),
- Anreize für Effizienz, Innovation und Spezialisierung,
- Nutzung von Skaleneffekten, Know-how und Reservekapazitäten privater Partner,
- Flexibilität im Personal- und Ressourcenmanagement,
- kommunale Einflussnahme über Gesellschaftsverträge, Gremien und Leistungsverträge.
Mögliche Nachteile von ÖPP:
- komplexe Vertrags- und Beteiligungsstrukturen,
- Steuerpflicht – insbesondere Gewerbe- und Umsatzsteuer (allerdings auch Steueraufkommen für die Stadt) –,
- Kontrollaufwand durch notwendiges Vertrags- und Leistungs-Controlling,
- Konflikte zwischen Gewinnorientierung privater Partner und Gemeinwohlzielen,
- Abhängigkeit von Vertragspartnern.
Welche Vor- und Nachteile sich tatsächlich ergeben, hängt letztlich auch von der Ausgestaltung der Verträge ab. Die Studie führt hierfür etwa die ÖPP AWISTA in Düsseldorf an. Hier wurden zur Verlängerung des Vertrags mit REMONDIS im Jahr 2025 die Gesellschaftsstrukturen so angepasst, dass die Gesellschafterrechte der Stadt ausgebaut wurden. Bei den Entsorgungsbetrieben Essen wurde wiederum in den erneuerten Leistungsverträgen festgelegt, dass die Stadt 60 Prozent der Gewinne erhält. Mehr Steuerungsmöglichkeiten oder höhere Gewinnbeteiligungen müssen also nicht zwangsläufig über eine Rekommunalisierung erfolgen.
Ein weiteres Fallbeispiel verdeutlicht zugleich, wie der einseitige Wunsch nach größerer kommunaler Autonomie auch negative Effekte erzielen kann: Bei der Stadtreinigung Dresden sind seit ihrer Rückabwicklung zu einem vollständig öffentlichen Unternehmen 2020 zwar die Mitarbeiterzahlen von rund 350 auf circa 450 gestiegen, zugleich ist jedoch der Gewinn um ein Drittel eingebrochen. Vor allem aber erhöhten sich die Gebühren innerhalb von vier Jahren gleich zweimal (zuletzt 2024 um ganze 23,4 Prozent), während es in der ÖPP zuvor in 16 Jahren lediglich eine Preiserhöhung gab.
Andererseits muss der Schritt zurück in die öffentliche Hand auch nicht immer einen Rückschritt bedeuten. So wurden etwa die Abfallwirtschaftsbetriebe Köln 2003 aus kartellrechtlichen Gründen bereits nach lediglich zwei Jahren ÖPP wieder rekommunalisiert. Das seither rein kommunale Unternehmen wirtschaftet heutzutage stabil und konnte in den letzten Jahren sogar hohe Gewinnüberschüsse an den Kölner Haushalt abgeben. Andernorts, in Tübingen, steht hingegen aktuell die Gründung einer ÖPP im Raum, um die von Dauerverlusten, Investitionsstau und Kostendruck geplagten Kommunalen Servicebetriebe Tübingen wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Klare Empfehlung gegen Rekommunalisierung für Bremen
Für Bremen kommt die Studie nach Analyse diverser Faktoren wie Leistungsverträgen, Kostentransparenz, Personalmanagement, Steuern, Innovation, Infrastruktur und Investitionsbedarf zum Schluss, dass von einer Rekommunalisierung der Abwasser- und Abfallwirtschaft abzuraten sei. Eine solche Maßnahme würde unter anderem hohe Investitions- und Finanzierungskosten verursachen und die kommunale Haushaltslage zusätzlich belasten. Zudem gäbe es keine Garantie für die erhofften Leistungs- und Gebührenvorteile, während sich die Innovations- und Effizienzpotenziale der Unternehmen wiederum reduzierten.
Die Empfehlung für die Hansestadt fällt damit eindeutig aus. Für alle anderen lässt sich unterm Strich festhalten, dass es nicht die eine Lösung gibt. Die Entscheidung „Verlängerung oder Rekommunalisierung“ hängt letztlich von vielen lokal- und unternehmensspezifischen Faktoren ab.