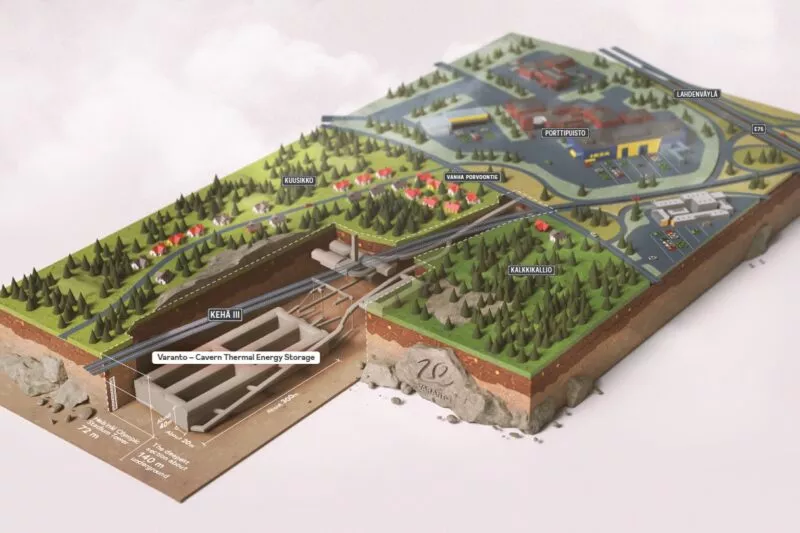Die Energiewende führt zu neuen Anforderungen im Stromsystem: Zwar liefern Sonne und Wind saubere Energie, ihre Verfügbarkeit variiert aber je nach Wetter und Tageszeit. Sogenannte „Dunkelflauten“ machen eine kontinuierliche Versorgung schwierig. Um Strom auch dann bereitzustellen, wenn er gerade nicht erzeugt wird, braucht es deshalb sowohl kurz- als auch langfristige Lösungen. Für eine kurzfristige Speicherung von Sekunden bis zu mehreren Stunden kommen derzeit vor allem Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Pumpspeicherkraftwerke und Druckluftspeicher können Strom mittelfristig, d.h. für mehrere Stunden bis wenige Tage vorhalten. Für die langfristige Speicherung von Strom über Tage bis Monate werden hauptsächlich sogenannte Power-to-Gas-Technologien genutzt, bei denen Strom in Wasserstoff umgewandelt und anschließend gespeichert wird. All diese Lösungen bringen jedoch Nachteile mit sich: hohe Kosten, großen technischen Aufwand oder begrenzte Einsatzmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse an thermischen Speichern, die Strom indirekt, beispielsweise durch die Umwandlung in Wärme, speichern.
Wie funktioniert eine Sandbatterie?
Eine besonders vielversprechende Technologie ist die sogenannte Sandbatterie. Dabei wird Luft mit Hilfe von überschüssigem Strom aus Wind- und Solarenergie auf bis zu 600 Grad Celsius erhitzt. Diese heiße Luft wird dann in einen mit Quarzsand gefüllten Stahlsilo geleitet, wo der Sand die Wärme aufnimmt und speichert. Dank seiner hohen Dichte und Hitzebeständigkeit kann diese Energie über Tage bis hin zu mehreren Monaten nahezu ohne Verluste gehalten werden. Wenn Wärme benötigt wird, beispielsweise zum Beheizen von Gebäuden, wird sie über einen Wärmetauscher kontrolliert wieder abgegeben. Sand als Speichermedium hat viele Vorteile: Er ist nahezu überall verfügbar, ungiftig, recycelbar und führt, anders als seltene Erden oder Lithium, die für Akkus benötigt werden, weder zu Umweltbelastungen durch den Abbau noch zu Lieferengpässen. Auch Bau und Betrieb einer Sandbatterie sind vergleichsweise kostengünstig und technisch weniger aufwendig als andere Langzeitspeicherlösungen. Sandbatterien sind robust, langlebig und weitgehend wartungsfrei. Sie eignen sich besonders gut für die saisonale Wärmespeicherung und können dabei helfen, den CO2-Ausstoß bei der Wärmeerzeugung deutlich zu verringern. Damit füllen sie eine zentrale Lücke in der Energiewende: die zuverlässige, nachhaltige Speicherung großer Energiemengen über lange Zeiträume.
Finnland macht es vor, Deutschland könnte folgen
Dass die Idee nicht nur auf dem Papier funktioniert, zeigt ein Pilotprojekt im südwestfinnischen Kankaanpää. Dort wurde bereits 2022 die erste kommerzielle Sandbatterie in Betrieb genommen. Sie versorgt ein lokales Fernwärmenetz, vor allem in den sonnenarmen Jahreszeiten, zuverlässig mit nachhaltig gespeicherter Wärme. Inzwischen sind weitere XXL-Speicher mit mehreren Megawattstunden Kapazität in Planung. Auch für Deutschland bietet das Konzept große Chancen. Denn mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs hierzulande entfallen auf den Wärmesektor, dessen Bedarf in den letzten Jahren trotz aller Effizienzmaßnahmen kaum gesunken ist. Noch immer stammt der Großteil der in Deutschland erzeugten Wärme aus fossilen Quellen. Im Jahr 2023 lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung laut Umweltbundesamt bei lediglich rund 18,8 Prozent. Um die nationalen Klimaziele zu erreichen, braucht es also vor allem in diesem Bereich schnell tragfähige Alternativen. Sandbatterien könnten dabei als flexible, CO₂-arme, bezahlbare Lösung dienen.
Kostengünstiger lokaler Wärmespeicher für Kommunen
Für Städte und Gemeinden bieten große Sandbatterien ein beachtliches Potenzial. Sie ermöglichen es, lokal erzeugte Überschüsse aus Wind- und Solarenergie verlustarm in Form von Wärme zu speichern und je nach Bedarf bereitzustellen. Als robuste und vergleichsweise wartungsarme Technik können sie auch als krisensicheres Backup-System fungieren, um eine Wärmeversorgung auch in Zeiten von Energieknappheit sicherzustellen. Dabei sind die Batterien durch ihre vergleichsweise niedrigen Investitions- und Betriebskosten selbst für kleinere Städte umsetzbar. Darüber hinaus setzt ihr Einsatz ein starkes Zeichen: Kommunen, die in innovative Speicheranlagen investieren, zeigen sich als zukunftsorientiert und nachhaltig. Nicht zuletzt kann der Einstieg in diese Technologie Förderchancen eröffnen, beispielsweise im Rahmen von Modellprojekten.